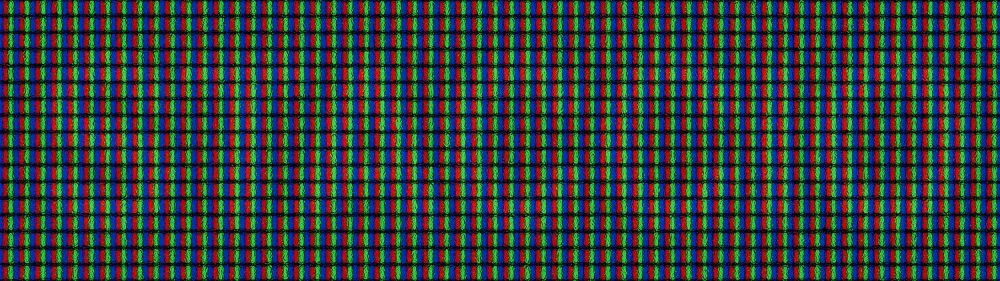"Staccio (Cervantes) (32:9)"
Tintenstrahldruck auf Acrylglas
Staccio (Cervantes) (32:9) ist Teil der Serie No Media Beyond This Point, in welcher Günther Selichar mit verschiedenen Begriffen wie DIFFÉRANCE, OBSERVING SYSTEMS, NOT HERE – THERE eine Verweiskette anlegt, die den philosophischen und theoretischen Rahmen für seine seit den 1980er-Jahren andauernde, intensive Auseinandersetzung mit Phänomenen rund um die Massenmedien abstecken kann. Andere Begriffe dieser Serie sind spontan und leichter – APPEAL und LIQUID – und spielen auf die Attraktivität an, die Medien auf ihre User:innen ausüben. Gemeinsam ist ihnen der Bezug zur Wahrnehmung via Monitor und das Unbehagen gegenüber einer systematischen Überwachung, das Widerstreben, das wir jedes Mal verspüren, wenn wir, unsere Augen auf einen Bildschirm gerichtet, Cookies zustimmen im vollen Bewusstsein, dass wir eben einen weiteren Stein geliefert haben, der das Puzzle zu unserem detaillierten persönlichen Profil im Netz vervollständigt.
Heinz von Foerster (1911–2002) hatte in seinen Schriften die Problematik des Beobachtens bereits thematisiert: „What we need now is the description of the ‚describer‘ or, in other words, we need a theory of the observer.“1 Umgekehrt entnehmen wir den Medien einen Großteil unserer Erfahrung, wägen Informationen und Gegenpositionen ab, vergleichen offizielle mit inoffiziellen Darstellungen, europäische mit außereuropäischen, und erwarten, nun umfassend informiert zu sein. Jedoch „erlaubt uns die mediale Meta-Welt keinen ungehinderten Durchblick auf die originalen Geschehnisse. Insbesondere in einer Notsituation wie jetzt (Covid-19), in der wir alternativlos diese Werkzeuge benützen müssen, zeigt sich unsere Abhängigkeit von diesen Maschinen einerseits, wie auch die Notwendigkeit, diese Werkzeuge und Strategien einer ständigen Reflexion zu unterwerfen.“2
In diesem unüberschaubaren Informationspool suchen wir nach Quellen des Vertrauens, nach seriösen Beiträgen, nach Berichten von Augenzeugen oder Journalisten, die aus der Mitte der Ereignisse authentisch die Sachlage, die Stimmung etc. wiedergeben können, wenn sie auch trotz allem subjektiv gefärbt bleiben, da jeder noch so neutrale Bericht von kulturellen, sprachlichen und vielen anderen Hintergründen der Journalist:innen, bzw. formalen Dingen wie Schnitt und Länge des Berichts beeinflusst ist. Erschüttert wurde das Vertrauen in den unabhängigen Journalismus 2003, als man im Zug des Irakkriegs vom „embedded journalist“ erfuhr – jener vom amerikanischen Militär eingeführten aktiven Mitnahme amerikanischer Journalisten an die Front. Man versprach damit dem Publikum eine spektakuläre Authentizität, konnte aber gleichzeitig lenken, was nach außen drang und was nicht.
Konzentriert auf den ersten der beiden Begriffe, EMBEDDED, löste Günther Selichar die Thematik vom Journalismus ab und führte sie hin zur Tatsache, dass alles, was wir über die Medien vermittelt bekommen, quasi „eingebettet“ ist, weil für unsere Augen und unsere Ohren aufgenommen, bearbeitet, geschnitten, zusammengestellt, ausgestrahlt etc., eben „apparativ gerichtet“3 wurde, da wir uns selbst kein Bild der Lage machen konnten. In Form eines überdimensionalen Schriftzugs, ebenfalls in seine RGB-Bausteine aufgelöst und auf eine LKW-Plane gedruckt, ließ Günther Selichar EMBEDDED während der Dauer seiner Ausstellung in der Tufts University Art Gallery auf einem 15,85 Meter langen Truck durch Boston fahren bzw. parken. 2006 war der Begriff in aller Munde. Entsprechend konnte die überdimensionale durch die Stadt rollende Warnung, welche Zugeständnisse wir bereit sind, an unsere Informationsversorger zu machen, Aufmerksamkeit erregen. 2020 sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir uns als User:innen im Netz „embedded“ fühlen: alles, was uns bewegt, wird dort bereits verhandelt, und alles was wir kaufen wollen, können wir uns quasi aus dem Netz liefern lassen. Das Angebot ist so vielfältig und attraktiv, dass wir kaum bemerken, dass es dort, wo die Big Player hinter verschlossenen Türen agieren, „No media beyond this point“ heißt – „ein dezenter Hinweis darauf, dass die durch Medien vermittelte Geschichte eben auch eine Geschichte der Auslassungen ist.“4 Alle Arten der Lenkung von Informationen wie Message Control, Public Relation, Fake News, Advertorials, Bildpolitik, Zensur bzw. deren politische und ökonomische Ziele auf der einen bzw. der Konsum dieser Botschaften auf der anderen Seite, sind Themen, die Günther Selichar eng an seine formalen medienimmanenten Untersuchungen knüpft. Kritisch beobachtet er auch die Phänomene rund um das Veröffentlichen (auch zunehmend privater Inhalte) im Netz – „Was treibt eine Gesellschaft dazu, sich derart zu publizieren …?“ Er nimmt sich selbst davon nicht aus, nützte etwa Infoscreens als Ausstellungsflächen im öffentlichen Raum, doch, „besorgniserregend ist der unreflektierte und verantwortungslose Umgang mit dem Publizieren.“5
1
Heinz von Foerster, Notes on an epistemology for living things, 1981, S. 258 [https://en.wikiquote.org/wiki/Heinz_von_Foerster].
2
Interview zwischen Ruth Horak und Günther Selichar im Juli 2020 für Eikon #112.
3
Günther Selichar, I publish, therefore I am – Fotografie und Öffentlichkeit, 2015, in: Die ersten 30 Jahre – Photographie, Hg. Anja Manfredi, Salzburg 2020.
4
Ebd.
5
Ebd.